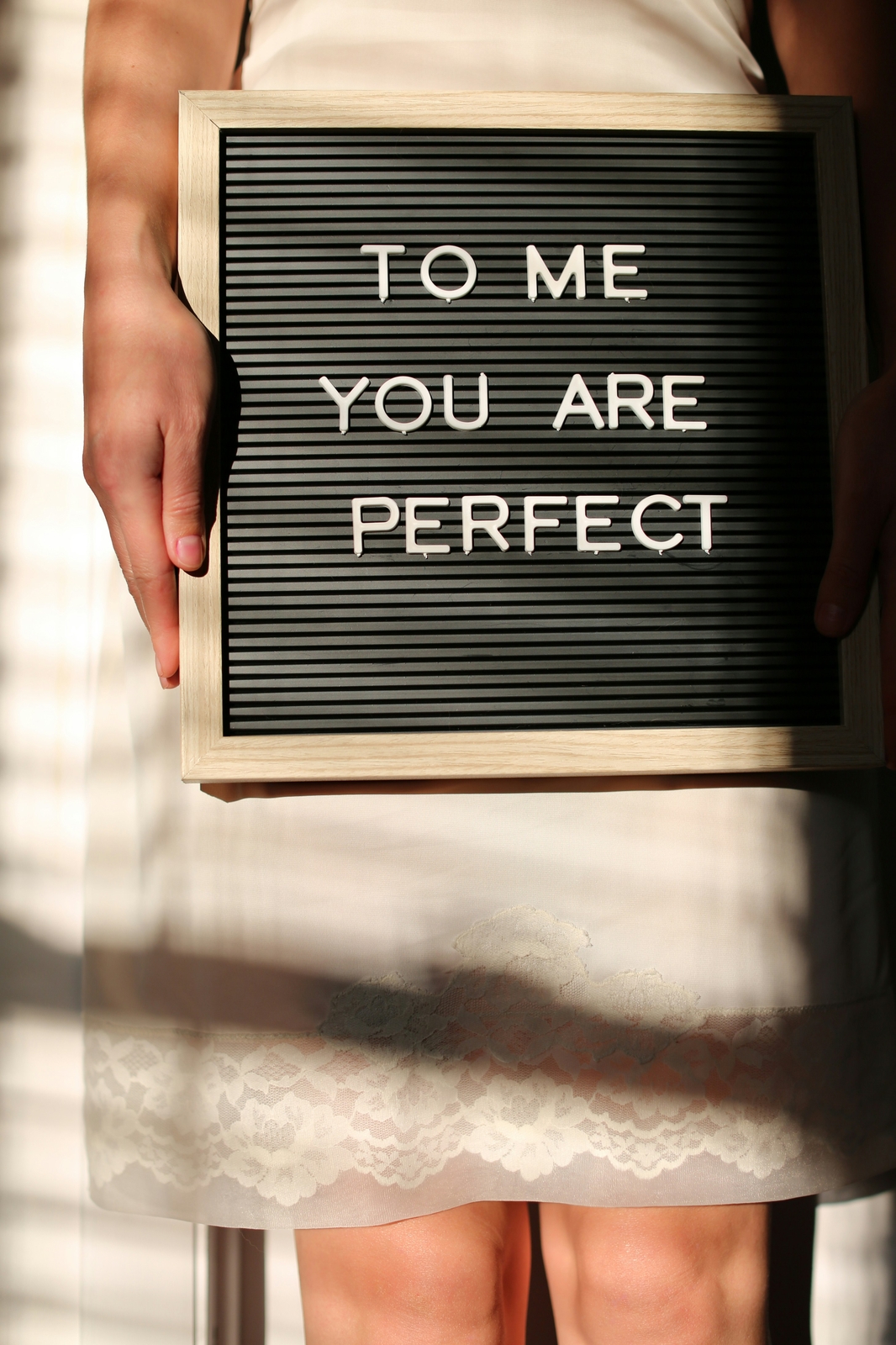
Perfektionismus wird oft als Stärke missverstanden. In Wahrheit ist er häufig ein selbstgebautes Gefängnis aus Gedanken, Erwartungen und Ängsten. Der Wunsch, alles richtig zu machen, entsteht selten aus Ehrgeiz, sondern aus der Angst zu scheitern. Perfektionismus klingt edel, aber er ist eine Falle des Geistes, die dazu führt, dass wir unsere Ideen zerdenken, bevor sie überhaupt Form annehmen.
Ich habe selbst oft erlebt, wie hinderlich dieser Anspruch sein kann. Der Drang, ein Projekt bis ins letzte Detail zu planen, kann lähmen. Ich erinnere mich an Momente, in denen ich beim Schreiben dachte: „Es muss noch besser werden.“ Doch mit der Zeit habe ich gelernt, dass 75 bis 80 Prozent oft reichen. Der Rest entsteht im Prozess. Die letzten 20 Prozent benötigen meist 80 Prozent der Zeit, und nicht immer ist diese Investition sinnvoll. Denn Perfektion ist kein erreichbarer Zustand, sondern eine subjektive Illusion.
Auch in Coachings mit Fach- und Führungskräften erlebe ich regelmäßig, wie gute Ideen scheitern, weil sie auf die „richtige Zeit“ oder den „perfekten Plan“ warten. Viele sagen „Ja, aber“, und ich antworte oft: „Mit Aber negierst du dein Ja.“ Hinter dem Aber steckt häufig Angst, ein innerer Dialog, der uns zurückhält.
Unsere Gedanken sind nichts anderes als Selbstgespräche. Sprichst du mit dir selbst wie mit einem Freund, der Ermutigung braucht, oder wie mit einem Kritiker, der immer das Haar in der Suppe sucht?
Ich sage mir in solchen Momenten oft: „Wird schon schiefgehen.“
Damit nehme ich mir den Druck, alles kontrollieren zu müssen, und schaffe Raum für Entwicklung. Fehler passieren, aber sie sind der Preis für Fortschritt. In Coachings arbeite ich deshalb mit meinen Klientinnen und Klienten an der inneren Kommunikation, an der Frage: Wie sprichst du mit dir selbst, wenn du zweifelst?
Selbstwirksamkeit bedeutet, an die eigene Handlungsfähigkeit zu glauben. Der Psychologe Albert Bandura hat gezeigt, dass Menschen mit hoher Selbstwirksamkeit weniger Angst vor Herausforderungen haben, weil sie Vertrauen in ihre Lernfähigkeit besitzen.
Auch Carol Dweck, Professorin für Psychologie an der Stanford University, spricht vom Growth Mindset, dem Glauben, dass Fähigkeiten durch Übung wachsen können. Perfektionismus ist das Gegenteil davon, er blockiert Wachstum, weil er Lernen mit Scheitern verwechselt.
In der Praxis sehe ich oft, wie Unternehmen Perfektion mit Professionalität verwechseln. Projekte werden ewig geplant, Prozesse bis ins Detail dokumentiert, während die Umsetzung stagniert. Doch Fortschritt entsteht nicht in Meetings, sondern im Machen. Fehlerkultur ist hier entscheidend, denn wer Fehler bestraft, verhindert Innovation. Ich selbst habe aus Fehlern oft mehr gelernt als aus Erfolgen, weil sie mich gezwungen haben, bewusster zu handeln und Entscheidungen besser zu reflektieren.
Lernen ist wie Schwimmen oder Fahrradfahren. Am Anfang ist die Angst groß, das Wasser zu tief, die Unsicherheit spürbar. Doch wer nie springt, lernt nie schwimmen. Auch im Berufsleben gilt: Wachstum findet nicht im gewohnten Umfeld statt, sondern dort, wo wir uns trauen, etwas Neues auszuprobieren, auch wenn wir noch nicht perfekt vorbereitet sind.
In meinen Coachings sage ich oft: „Dein Leben ist ein Prozess.“
Wir sind nie fertig, und genau das ist die Chance. Jeder Versuch, jede Erfahrung, jedes Gespräch fügt sich wie ein Puzzleteil zu einem größeren Bild. Manchmal fehlen Teile, manchmal passen sie nicht sofort, aber mit Geduld und Offenheit entsteht etwas Ganzes.
Selbstverwirklichung bedeutet nicht, ein Ideal zu erreichen, sondern sich selbst zu erkennen, mit Stärken, Schwächen und allem, was dazugehört. Es geht darum, Entscheidungen zu treffen, nicht weil sie sicher sind, sondern weil sie wichtig sind.
Fazit: Mut zur Unvollkommenheit
Perfektionismus ist kein Zeichen von Qualität, sondern oft ein Ausdruck von Angst.
Wer darauf wartet, dass alles perfekt ist, wird ewig warten.
Echter Fortschritt entsteht, wenn wir handeln, reflektieren und weitermachen.
Leben heißt, unfertig zu bleiben und trotzdem zu wachsen.
Denn das Streben nach Perfektion führt zur Stagnation, während Akzeptanz der Unvollkommenheit Raum für Entwicklung schafft.


